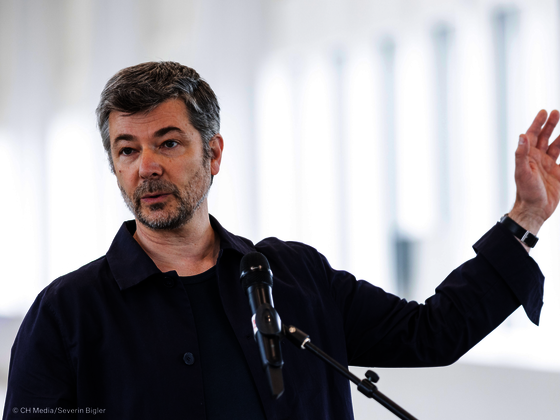Wer beeinflusst, wie sich eine Stadt entwickelt?
In der Schweiz gibt es aktuell den Konsens, dass die Stadt- oder Siedlungsentwicklung möglichst geordnet ablaufen soll. Um dies sicherzustellen, gibt es diverse Planungsinstitutionen auf verschiedenen Ebenen: Stadt, Region, Kanton, Bund. Wie sich eine Stadt konkret entwickelt, hat mit dem Willen der Politik und den damit verbundenen Möglichkeiten der zuständigen Ämter zu tun. Aber auch Investoren spielen eine grosse Rolle, welche die Planungskonzepte baulich umsetzen. Städte selbst sind auch eine Art Investoren: sie besitzen eigene Grundstücke und v.a. den öffentlichen Grund (Strassen und Freiräume). So können sie direkt beeinflussen, wie diese Räume gestaltet werden – ein Thema von zunehmender Wichtigkeit, das die Qualitäten einer Stadt wesentlich mitprägt. Zu einzelnen Planungsthemen wie z.B. der Festsetzung von Zonenplänen oder der Finanzierung grösserer, öffentlicher Bauvorhaben können sich jedoch auch die Bürgerinnen und Bürger in öffentlichen Vernehmlassungen oder an der Urne äussern.
Wie und in welchem Umfang kann die Raumplanung diese Entwicklung aktiv steuern?
Wir müssen unterscheiden zwischen Planung, Projektierung und Umsetzung. Die Raumplanung macht Zielvorgaben in Form von Planungsinstrumenten wie z.B. Richtpläne oder Zonenpläne, in denen die verschiedenen Bedürfnisse der Raumnutzung aufeinander abgestimmt werden. Diese sind behördenverbindlich und müssen bei Bewilligungsprozessen berücksichtigt werden. Wie das Ganze dann konkret aussieht, wird in der Projektierung bestimmt – im Idealfall mittels Qualitätsverfahren (Testplanung, Studienauftrag, städtebaulicher Wettbewerb usw.). Auf die bauliche Umsetzung hat die Raumplanung jedoch keinen Einfluss. Sie wird das Entstandene zyklisch interpretieren und als neue Ausgangslage für künftige planerische Notwendigkeiten betrachten. Raumplanung ist ein permanenter, nie abgeschlossener Prozess.
Welche Faktoren spielen dabei eine besonders wichtige Rolle?
Griffige Planungsinstrumente wie die erwähnten Richtpläne sind ausserordentlich wichtig. Deren Erarbeitung ist ein multidisziplinärer Prozess, bei dem es gilt, die diversen Ansprüche an den Raum zu erfassen und eine gemeinsame Strategie für seine weitere Entwicklung zu finden. Sie werden aus der Analyse der gegenwärtigen Situation und aus Prognosen für die Zukunft (Demografie, Verkehr, Klima usw.) hergeleitet. Aus diesen Erkenntnissen wird dann ein Handlungsbedarf für die bauliche Entwicklung oder den zukünftigen Verkehr formuliert und dargestellt. Dieser Prozess verläuft keineswegs linear oder harmonisch und nimmt in der Regel sehr viel Zeit in Anspruch.
Können sich diese Faktoren und deren Relevanz im Laufe der Zeit verändern? Wenn ja, aus welchen Gründen?
Die oben beschriebenen Prozesse haben sicher eine gewisse Gültigkeit, solange die Gesellschaft weiterhin demokratisch organisiert ist. Inhaltlich muss die Planung jedoch auf veränderte Bedürfnisse der Gesellschaft, auf die Möglichkeiten der Wirtschaft oder auf äussere Faktoren wie Zuwanderung, Klima- und Umweltfragen oder die zunehmende Digitalisierung reagieren. Dies kann durchaus zu einer Verschiebungen von Prioritäten führen. So bekam beispielsweise das Thema der Innenverdichtung auf Grund der schwindenden Baulandreserven vor einigen Jahren eine immer stärkere Bedeutung.
Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die Schnittstelle von öffentlichem Raum und öffentlichem Verkehr. Was sind die grössten Herausforderungen in diesem Bereich?
Bei diesen Aufgaben geht es nicht nur um Gestaltung, sondern vor allem auch um Vernetzung. Diese Räume sind Teil eines Geflechts städtischer Bewegungsräume. Hier treffen verschiedene Funktionen und Geschwindigkeiten aufeinander; hier wird umgestiegen, gewartet, eingekauft, geschlendert und gerannt. Gerade bei Bahnhöfen oder Haltestellen, die wegen der Gleise eine trennende Wirkung im Stadtraum haben, wird die beidseitige Zugänglichkeit resp. die Verbindung über/unter den Gleisen immer wichtiger. Bahnhöfe erhalten dadurch eine Art Zentrumsfunktion und damit eine wesentliche Bedeutung für die Entwicklung des Umfeldes. Die Gestaltung solcher Räume ist anspruchsvoll, weil sehr viele Interessen abgeholt und unter einen Hut gebracht werden müssen. Je breiter der Prozess abgestützt ist, desto besser werden diese Räume künftig von der Bevölkerung angenommen.
Was bedeutet der Megatrend Urbanisierung für den Grossraum Zürich und seine Einwohnenden?
Es ist wichtig, wie der Betriff «Urbanisierung» verstanden wird. Er könnte mit dem etwas in die Jahre gekommenen Begriff «Verstädterung» übersetzt werden, was eindeutig negativ konnotiert wäre und die Stadt als umlandfressendes Monster erscheinen liesse. Der Begriff «Stadtwerdung» hingegen wäre eine etwas versöhnlichere Übersetzung und suggeriert eine qualitative Entwicklung.
In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat tatsächlich eine Verstädterung des Metropolitanraums Zürich stattgefunden, d.h. eine eher unkontrollierte Entwicklung zwischen Stadt und Land, welche einige unklare Räume hervorgebracht hat. Dies hatte insbesondere auch mit der Mobilität zu tun – mit der allgemeinen Verfügbarkeit des Autos, aber auch mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Nun müsste es unter dem Stichwort Verdichtung darum gehen, diese Zwischengebiete im positiven Sinne zu urbanisieren resp. zur «Stadt werden» zu lassen, damit sie eine eigene Identität entwickeln können. Verdichtung muss zu mehr lokalen Qualitäten führen. Dazu können auch die Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs einen grossen Beitrag leisten, die ihr Umfeld in der Regel aufwerten. Vielleicht wird das Quartier dereinst die Stadt als massgebende Einheit ablösen.
Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die Mobilität?
Mobilität wird auch künftig sehr wichtig sein, selbst wenn sich der Trend zum Homeoffice oder flexiblen Arbeitszeiten verstärken sollte. Mobilität bedeutet eben auch Freiheit. In einer sich zunehmend verdichtenden Siedlungsstruktur wird der Platzbedarf zum grossen Thema, um den sich Verkehrsmittel schon heute streiten. Das Auto braucht zu viel Platz, weil es oft unternutzt ist und die meiste Zeit nur herumsteht. Es wird also insbesondere in den Städten eine Umverteilung innerhalb des Verkehrsraumes geben müssen. Wie das Beispiel Paris zeigt, wo Fahrspuren radikal abgebaut und dem öffentlichen Verkehr oder dem Velo zugeschlagen werden, können solche Veränderungen sehr viel stadträumliche Qualität erzeugen. Ähnliches hat ja auch die ETH kürzlich für Zürich aufgezeigt. Meine Hoffnung ist, dass der öffentliche Verkehr und der Fuss- und Veloverkehr weiter zulegen kann. Dies würde die Lebensqualität in unseren Städten nochmals einiges verbessern.